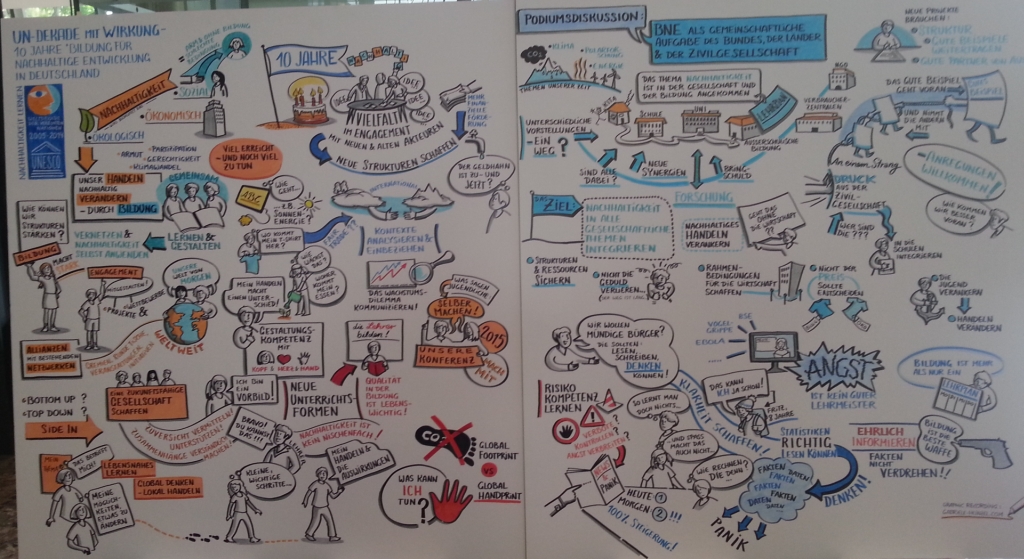Fragt man danach, was Nachhaltigkeit im Kontext der Klimaveränderung oder des Ressourcenabbaus bedeutet, dann ist eine Antwort relativ klar, wir müssen den kommenden Generationen eine lebensfähige Mitwelt hinterlassen. Wie steht es aber mit der Digitalisierung und ihren aktuellen und zukünftigen Konsequenzen?
Spätestens, wenn man in einer U-Bahn sitzt, und den größten Teil der Fahrgäste auf ihre Smartphones starren sieht, wird einem klar, dass kleine Geräte mit ihrem Funktionsumfang eine Gesellschaft verändern können. Vor einem Jahrzehnt hätten zwei jugendliche Freundinnen miteinander geplaudert, gekichert und sich gegenseitig berührt, heute sind sie im Zweifelsfall in ihre Smartphones versenkt, als gäbe es da einen Schatz zu heben, dessen Bergung keine äußere Störung erlaubt. Werden diese Freundinnen des digitalen Miteinanders als Erwachsene anders sein, als ihre Vorgängerinnen, die noch das analoge Miteinander pflegten? Und wenn sie anders sein sollten, ist das Andere dann „schlechter“ als das Vergangene?
Eine solche Frage lässt sich nicht „objektiv“ beantworten. Will man sich nicht beliebig einem „waltenden“ Prozess aussetzen, muss man ihn mitgestalten, muss ein Werturteil beziehen und dafür eintreten. Aber verstehen wir die Entwicklungen überhaupt, und haben wir Kriterien, um zukünftige Entwicklungen zu bewerten?
Wir brauchen zur eigenen Meinungsbildung Experten. Gesellschaften, die sich im Transformationsprozess befinden, haben jedoch immer ihre Kulturpessimisten und ihre Utopisten. Folgen wir dem Neurologen Spitzer, dann führt uns die Digitalisierung in die massenweise Verdummung. Folgen wir der Sozialwissenschaftlerin Sherry Turkle, dann hat sie uns 2006 empfohlen, die sozialen Netze, in denen sich die Jugend tummelt, als eine positive Entwicklung zu sehen, die zu mehr sozialer Nähe, zu mehr Bindungsmöglichkeit, zu mehr Selbstbestimmung führe. Und im Jahre 2012 aufgrund ihrer aktuellen empirischen Analysen kommt sie zum gegenteiligen Schluss und schreibt vom Terror und von individueller Verwüstung, die die sozialen Netze bei ihren untersuchten Jugendlichen anrichten. Folgt man dem Informatiker und Sciencefiction-Autor Suarez, dann führen die Datenvernetzung, Algorithmen und digitale Steuerungstechnologie zu automatisch kämpfenden Kriegswaffen, die zu globaler Unterdrückung und Entmenschlichung führen. Ausgerechnet die Kritiker vom Chaos Computer Club schwärmen von der Befreiung der Arbeit und einer schönen Neuen Welt, wenn die Digitalisierung konsequent zu Ende entwickelt wird.
Expertenlektüre ist wichtig, um halbwegs über den aktuellen Stand und Entwicklungstendenzen informiert zu sein. Die Bewertung müssen wir selber leisten. Hilfreich ist in jedem Falle eigene Erfahrung. Man kann nicht über Facebook vom Leder ziehen, wenn man dieses Netzwerk gar nicht aus eigener Anschauung kennt. Man urteilt blind über jugendliches Kommunikationsverhalten, solange man nicht selbst versucht, deren Perspektive einzunehmen und zu verstehen.
Wenn man denn glaubt, verstanden zu haben, worum es geht, kann man Kriterien wählen. Und als aufgeklärter Mensch, ist mein Kriterium nicht, ob mich ein Gadget von Gott entfremdet, sondern ob es meine Selbstbestimmung erhöht, ob es zu sozialem Ausgleich beiträgt, ob es keine Naturzerstörung impliziert, etc. An diesem Kriterienbeispiel wird deutlich, dass hier eine politische Wertung gefällt werden muss. Ein religiös-orthodox orientierter, oder ein Wertkonservativer wird andere Kriterien wählen, als ein Fortschrittsgläubiger, als ein Liberaler, etc.
Ob die Phänomene, die mit der als „Digitalisierung“ beschriebenen Prozesse einhergehen, in die „falsche“ (nicht zukunftsfähige = nicht nachhaltige) Richtung laufen, kann ich anhand meiner Kriterien für mich entscheiden. Und wenn ich das beobachte, kann ich versuchen, entgegen zu steuern. Wenn die ganze Zivilgesellschaft, per Druck auch die Politik, oder engagierte Unternehmen gegensteuern, wird sich die zukünftige Entwicklung verändern. Nachhaltiges, bzw. zukunftsfähiges Handeln ist immer eine Option auf eine mögliche „bessere“ Entwicklung, an der ich arbeiten muss, für die ich mich einbringen muss. Es ist aber auch Resultat politischen Austauschs. Es bedarf Mehrheitsfindungen zumindest bei den Entscheidenden, um relevantes Handeln zu ermöglichen.
Auf der politischen Ebene hat der Abhörskandal der NSA, ausgelöst durch den Whistelblower Snowden (im Sommer 2013) eine katalytische Wirkung. Dass wir unablässig Datenspuren hinterlassen, die abgegriffen werden, mit Algorithmen gebündelt und interpretiert werden können, ist schon lange bekannt. Einschlägige Literatur dazu ist vorhanden (z.B. Die Datenfresser von Constanze Kurz, Frank Rieger), aber es bleibt folgenlos. Die Teilnehmerzahlen am sozialen Netzwerk Facebook wachsen jährlich. Das Smartphone, bzw. die mobilen Geräte werden zu systematischen Datenräubern ausgebaut, was ihrer Beliebtheit allerdings keine Schranken setzt. Mit der NSA-Affäre ist das Thema wieder stark in die Medien gerückt. Und das Enthüllungsmaterial ist so riesig, dass über Monate immer wieder neue schockierende Offenlegungen über staatlich geheimdienstlichen Datenmissbrauch erfolgen.
Was tun? Es gibt eine kleine Parallele zur Ökobewegung. Ich kann individuell handeln. Ich kann mein persönliches Verhalten ressourcenschonender arrangieren. Weniger Fliegen, weniger Autofahren, weniger Fleisch essen, mehr Naherholung pflegen, mehr Langsamkeit genießen, mehr Stress abbauen, etc. Gesellschaftlich kann ich mich für eine bessere Strukturpolitik, für die Durchsetzung der Energiewende, für sozialen Ausgleich mit den Ländern des Südens einsetzen, etc. Bei der Digitalisierung entspricht dem individuellen Verhalten die persönliche Verriegelung meiner Internetpforten. Threema statt Whatsapp, Textsecure statt offener SMS, PGP-verschlüsselte Mails statt der offenen Postkartenmail. Aus Facebook austreten, das gmail-Konto liquidieren, Google nicht mehr als Suchmaschine nutzen, den Browser mit No-skript verriegeln, und vielleicht noch mit Tor oder Winsweep die IP-Adresse verunkenntlichen. Diese Abschottungen haben einen Preis, der mit der kleinen Schadenfreude, dass die NSA und die Datenkraken nun etwas mühsamer an mein Profil kommen, wenig kompensiert wird. Das Verschlüsseln ist mindestens so umständlich, wie ein Bügelschloss an Radrahmen und Zaunpfahl anzubringen, das Vorderrad umschließen und den Sattel sichern… Wer alles verrammelt, der erhält keinen Besuch mehr. Wenn ich nicht mehr Auto fahre, kann ich die Fußgänge, die neue Sicht auf meine Umgebung, den Zuwachs an Bewegung genießen. Wo bleibt der kompensatorische Genuss bei der Verschlüsselung meiner Kommunikation mit der Welt? Hört hier die Parallele zur Ökobewegung auf? Der persönliche „Zweikampf“ mit der Datenausspähung kostet Kraft, Kompetenz und viel Komforteinbuße und ist genauso unangenehm, wie das Verrammeln der Häuser gegen den Diebstahl.
Allerdings sind die genannten Schritte nicht nur präventiv, sie enthalten das aktive Element des Einsatzes gegen Machtkonzentration und Monopolisierung im Internet. Ein weiterer Aktivposten ist die mündige Netznutzung. Google und Co. wollen den Werbebotschaften empfangenden, den in seinem eigenen Denken bedienten (Filter bubble) zahlungs- und kaufwilligen Netzkonsumenten. Das nachhaltige Gegenbild dazu ist die sich einbringende Netzcommunity. Mit Blogger und Twitterinnen (#aufschrei) aus der Basis heraus Öffentlichkeit schaffen zu Themen, die im Mainstream unterzugehen drohen. (Informationelle) Selbstbestimmung ist eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie, die Voraussetzung für einen allgemein verantwortlichen Umgang mit den Naturressourcen ist. Wenn schon eine Demokratie nur in Gesellschaften funktioniert, die über eine solide Mittelschicht und ein entwickeltes Bildungssystem verfügen, so setzt aktive Netztätigkeit um so mehr einen guten Bildungsstand breiter Bevölkerungsschichten voraus. Auf Facebook Privatfotos zu posten, schafft jeder Schulabbrecher, aber eine valide Recherche zu einer politischen Frage oder auch zu einem Alltagsproblem durchzuführen, setzt einen gewissen Bildungsstand voraus, aufgrund dessen erst eine gescheite Frage formuliert, und die Internetquellen entsprechend bewertet werden können.
Auch bei der Wahl der Programme, der man sich bedient, besteht eine Gestaltungsmöglichkeit. Kommerzielle Software hat ihre Berechtigung in hoch spezialisierten, beruflichen Anwendungen, wo sie Teil des kapitalistischen Verwertungsprozesses ist. Wenn allgemein benötigte Internetwerkzeuge, wie Textverarbeitung, Bildbearbeitung, Browser, Mailprogramme, alle Sorten von Hilfstools, etc. kommerziell produziert werden, unterliegen sie schon aus Gründen der allgemeinen Kompatibilitätsforderungen einer Monopolisierungstendenz. Wie eine nichterneuerbare Ressource verlieren sie mit der Zeit an Wert und müssen durch eine neue Variante ersetzt werden, die auch wieder einen Kaufpreis erfordert. Wie bei der Nutzung fossiler Ressourcen schädliches CO2 anfällt, birgt die Nutzung der Software der Global Players den Verlust der Privatsphäre. Die Geheimdienste der Länder marschieren ein und aus, Kriminelle greifen Monopolsoftware gerne an, denn eine einmal gefundene Lücke ermöglicht den Zutritt zu Millionen. Dagegen ist Open Source mehr eine erneuerbare Quelle. Sie wird sozial erzeugt, und von einer Gemeinde stetig weiterentwickelt. Die anfallenden Kosten können über Spenden getragen werden, weil keine Profit erwirtschaftet werden muss und die Produktentwicklung sich auf Viele verteilt, die teilweise aus Eigennutz entwickeln, und das Ergebnis sozialisieren. Da der Quellcode offen ist, können Experten überwachen, ob verbotene Türen die Software zur Madeware machen. D.h. Open Source ist eine erneuerbare Ressource bzgl. der digitalen Nachhaltigkeit.
Betrachtet man den Zugang zu Ressourcen, der für alle Schichten und alle Länder im nachhaltigen Sinne gleich gerecht verteilt sein sollte, dann gibt es noch viel zu tun. Die aktuelle Ungleichverteilung der (materiellen) Ressourcen in der Welt spiegelt sich im Netz. Amerika als reichster Standort beherrscht die Spitzenforschung der Welt, mit der Konsequenz, dass der innovative Motor der Welt einen angelsächsischen kulturellen Bias hat. In der Pharmaindustrie wird nur entwickelt, was langfristigen Profit verspricht. So wird viel Risikokapital, das vor allem in den reichsten Ländern steckt, nur für solche Entwicklungen investiert, die Gewinn versprechen, etc. Das Netz ist nicht der Ursprung dieser Probleme, ab er es verteilt und verstärkt sie. Die Antwort darauf kann nicht sein, das Netz zu nationalisieren, über gezielte Netzpolitik muss für offene Zugänge gekämpft werden, die Schwachen bedürfen der Unterstützung.
Digitalisierung, das klingt so materielos, ist es aber nicht. Um Zugang zum Netz zu bekommen, werden Milliarden Geräte mit Bedarf an seltenen Metallen gebaut, um Informationen zu speichern entstehen riesiger Serverfabriken mit gewaltigem Energiehunger. Auf Nachhaltigkeit konzipierte Geräte sollten eine andere Struktur haben, energiesparsam, sozial gerecht erzeugt, materiearm und nicht den Moden unterworfen. Die Entwicklung vom stromfressenden PC zum Tablet-Computer, und schließlich zum Smartphone als Allrounder ist an sich richtig, wenn da nicht die großen Anzahlen dahinter stünden. Künstliche Veralterung einberechnet, das wahnsinnige Entwicklungstempo, und der Sozialdruck des „Habenmüssens“ führen dazu, dass nahezu jeder Einwohner eines wohlhabenden Landes pro Jahr mindestens ein Smartphon durch ein neues ersetzt, ohne dass es vernünftige Recyclingmöglichkeiten für die ausgedienten Geräte gäbe. Das „Fairephone“ ist in Ansätzen da, das Teilen und leihen von Geräten muss noch entwickelt werden.
Sorry, so lange sollte der Beitrag nicht werden – und dennoch ist das Meiste nur angerissen.