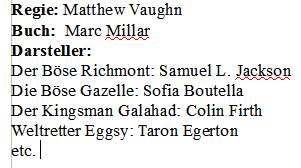Ein Film zur Künstlichen Intelligenz (KI) und noch dazu ein sehr gelungener, ist immer eine reizvolle Studie für einen Computerfreak. „Ex_Machina“ ist das Regiedebüt des Drehbuchautors Alex Garland, der kammerspielartig die Frage nach der künstlichen Intelligenz ohne Weltuntergangsgedröhne, Ballerei und Straßenverfolgungsrennen einfach mit Dialogen durch und über den berühmten Turing Tests erzählt. Zur Inszenierung kann man die meist lobenden Kritiken nachlesen. Der Plot ist einfach: Der Erfinder Nathan, Besitzer des größten Suchmaschinenkonzerns „Bluebook“ lädt seinen begabtesten, als brav und ohne Freundin lebenden Programmierer Caleb in seine Forschungsfestung ein, damit dieser einen Turing-Test mit der Computerfrau Ava durchführt, um herauszufinden, ob diese wirklich eine menschengleiche Intelligenz besitzt. Ich habe im Abspann keinen Hinweis zu einem wissenschaftlichen Berater gefunden, und vermute auch, dass Garland (im Unterschied zu Kubrick anlässlich seines Science Fiction Films „2001: Odyseee..“) keine eigenen tieferen Recherchen zur KI-Forschung angestellt hat. Insofern spiegeln die kleinen Details im Plot die aktuellen Zukunftsbilder, die sich informierte, kreative Leute heute von zukünftigen technischen Entwicklungen machen. Ein Science Fiction entsteht in der Regel dadurch, dass man die aktuellsten technologischen Neuerungen noch etwas weiter nach vorne denkt, was häufig nur zu sehr mageren Visionen führt.
Die Plotfiguren sind aktuell hoch vertraut, Bluebook steht für Google und Datamining, der Protagonist ist ein liebenswerter Computernerd und Ava ist eine sehr sexy Superfrau, die aus einem beliebigen Modejournal entsprungen sein könnte. Allerdings ist der Erfinder Nathan nicht ein grauhaarig, weise blickender Alter, sondern exzentrisch, etwas sehr körperbetont, dass man ihm seine gigantische Forschungskapazität eigentlich nicht ansieht. Und der Programmierer Caleb ist gar nicht nerdisch verklemmt, sondern in der Lage, sehr lebensnahe, intelligente und einfühlsame Fragen an seine Computerdame zu stellen, um sich, was zu erwarten war, in sie zu verlieben. Auch der Turing-Test erfährt eine Variation (die im Film auch kommentiert wird). Das zu befragende Etwas, das man als Computer oder als Mensch zu identifizieren hätte, wird hier sofort als Computerwesen offenbart. Man sieht der Computerfrau an Hüfte und Beinen deutlich an, dass sie eine Maschine ist. Damit, dass es sich hier offensichtlich um eine computergesteuerte Maschine handelt, ist der Test aber nicht zu ende. Caleb soll herausfinden, ob dieses Computerwesen denkt und empfindet wie ein Mensch – oder eben, ob diese Eigenschaften bloß vorprogrammiert simuliert werden.
Die Handlung soll hier nicht weiter dekliniert werden. Interessant ist, dass wir heute, wo es scheinbar selbstverständlich scheint, dass Computer alles „wissen“, die Menschlichkeitsfrage nicht in der Wissensakkumulation, sondern in der Gefühlsebene suchen. Als Marvin Minsky 1956 den Begriff „artificial intelligence“ kreierte, war es noch wichtig, mit dem Computer die Wissenskraft des Gehirns überbieten zu wollen. Je mehr man lernte, was der Begriff Intelligenz eigentlich umfasst, wie er zu messen sei, desto mehr kam auch der Körper und sensitive Erfahrung von Welt für die Kognition ins Spiel. Die kognitive Psychologie nahm sich der Intelligenzfrage an. Die KI-Forscher glaubten zu Beginn noch, die Hirnfunktionen über programmierbare Regeln abbilden zu können. In Analogie zur Gehirnstruktur wurde die Metapher neuronaler Netze systembildend. Mit Neuroinformatik werden mathematische Modelle künstlicher neuronaler Netze konstruiert, die ähnlich operieren, wie einfache biologische neuronale Netze. In der Mustererkennung und auf anderen Gebieten gibt es durchaus erfolgreiche Anwendungen, aber im Bereich der künstlichen Intelligenz sind die Wissenschaftler mit derart regelbasierten programmierten Strukturen bislang nicht gut vorangekommen. Viel erfolgreiche in Sachen Prognose menschlichen Verhaltens oder z.B. im Bereich der Sprachbildung und Übersetzung war in den letzten Jahrzehnten die geballte Stochastik, bzw. das Durchsuchen riesiger Datenmengen nach Ähnlichkeiten (aktuelles Neudeutsch: Bigdata). Wenn Google heute einen Text übersetzt, dann geschieht das nicht nach syntaktischen und semantischen Regeln, sondern es werden aus Datenbeständen bestehende Übersetzungen durchforstet und nach Sätzen gesucht, die der zu übersetzenden Vorlage entsprechen, das wird noch mit heuristischen Regeln abgeglichen, und dann kommt die Übersetzung heraus, hinter der keinerlei Sprach- und Sinnverständnis steht, die aber heute schon halbwegs funktioniert, und zukünftig wohl noch besser werden wird. Die moderne Form der KI besteht gewissermaßen darin, mit Null-Intelligenz ein Produkt zu erzeugen, das eigentlich nur von einem intelligenten Wesen erzeugt werden kann.
Uns wird in den Filmdialogen erklärt, dass Ave mit Mikromimik die Gefühle von Caleb erkennt. Zu jedem Gefühlsausdruck gibt es je nach Kulturkreis eine bestimmte Gesichtsmimik. Die Gefühlswelten und die zugehörigen Gesichtsausdrücke sind natürlich so vielfältig, dass ein regelbasiertes System der Gesichtsmimik nur sehr beschränkt prognosetauglich ist. In Bluebooks wird aber hierzu Bigdata angewendet, so dass aus Millionen Videoaufzeichnungen mit Sprachspeicherung wie beim Übersetzungsmechanismus aus einem Ähnlichkeitsabgleich auf den Gefühlsausdruck geschlossen werden kann. Hier wird dem Zuschauer angedeutet, das Ava Gefühle erkennen kann, ohne zu wissen, was ein Gefühl ist. Mit der Wahl des Suchmaschinenmoguls als Entwickler der KI-Frau greift der Drehbuchautor auf den aktuellen Wissensstand zurück , dass mit Bigdata die größten Erfolge zu erzielen sind.
Auch die Rechnerarchitektur unterscheidet sich erheblich. Weil zu Kubricks Zeit (1968) noch der Großcomputer dominierte, verstaut er das Computergehirn Hal in eine große Schrankwand im Raumschiff. Mit den extremen Miniaturisierungsfortschritten in der Chiptechnik darf das Gehirn von Ava schon in eine wabernde Biochiphülle schlüpfen, die der menschlichen Gehirnmasse nahe kommt. Das ist heute auch noch lange nicht realistisch, aber zeitgeistlich denkbarer als zu Kubricks Zeiten.
Wo der Film m.E. eine Drehbuschschwäche aufweist, ist die Behandlung des künstlichen Körpers. Einerseits spielt der Film mit dem Paradigma, dass Intelligenz und Körper eine Einheit bilden (was populär damit gestaltet wird, dass die Computerfrau vögeln kann), aber die Frage, wie ist ein künstlicher Körper beschaffen, der diese Einheit leisten kann, spielt im Plot keine bzw. nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wir erfahren, dass beim „upgraden“ einer Computerfrauversion wesentlich Software ausgetauscht wird, der Körper aber wiederverwendet wird, weil der so kostbar ist. Dass Nathan nicht nur ein begnadetes Softwaregenie ist, sondern auch noch die Fähigkeit hat, in einem 20 mal 20 Meter Labor einen hoch komplexen Kunstkörper allein zu basteln, scheint mir auch als kühne Vision etwas platt. Der Film sollte ein Kammerspiel sein, da hätten weitere Personen wohl den Rahmen gesprengt, aber die fehlen mir dann doch – schade.
Während der im Vorjahr erschienene Science Fiction Film Interstellar seinen Plot mit einer nicht unumstrittenen Theorie des Wurmlochs relativ theorienah unterfüttert, ist offensichtlich die Affinität von Ex_Machina zur KI weniger strikt, so dass die filmische Darstellung über denkbare Sachzwänge gesetzt wird. Das tut dem Film gut, und dem sinnieren über heutige Auffassungen von KI keinen Abbruch.
April 2024 M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Kale Casper bei Der Bundesumweltwettbewerb und Künstliche Intelligenz
- izmir travesti bei Hackerspace in Frankfurt
- HApel bei Narrationen der Nachhaltigkeit
- Thomas Klein bei Narrationen der Nachhaltigkeit
- monika voelker bei Vom HOMO S@APIENS zum HOMO DEUS
Archive
- März 2024
- Dezember 2023
- Dezember 2022
- Januar 2021
- November 2020
- April 2020
- Februar 2020
- November 2019
- April 2019
- Februar 2018
- Dezember 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Februar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- April 2016
- März 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- Mai 2015
- März 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Mai 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
Kategorien
Blogroll
Blogs zu BNE
Meta